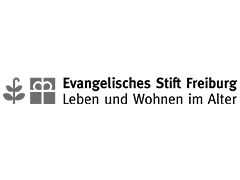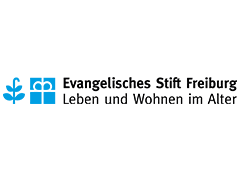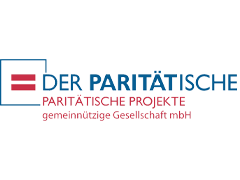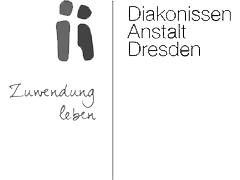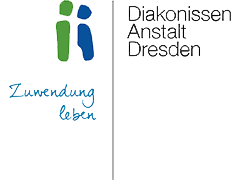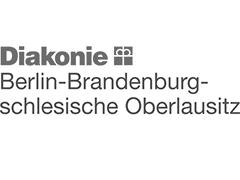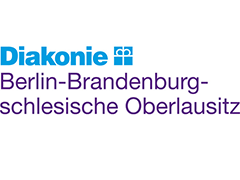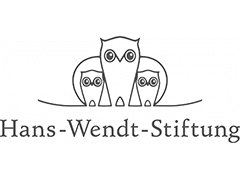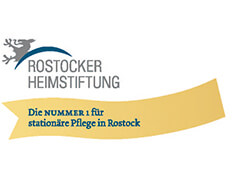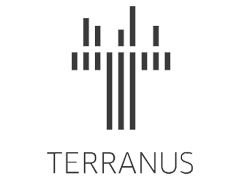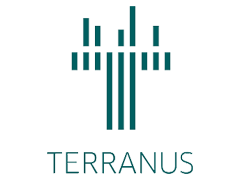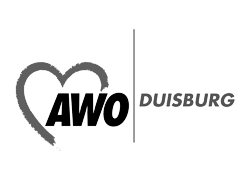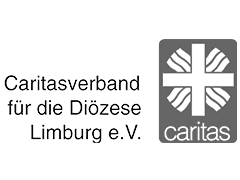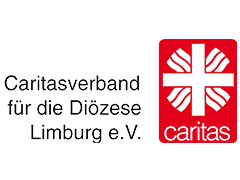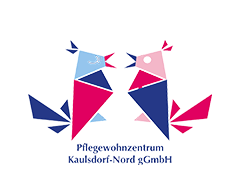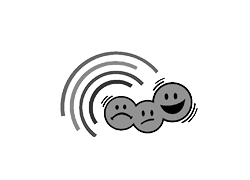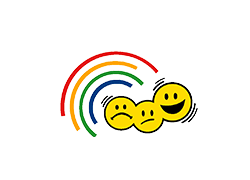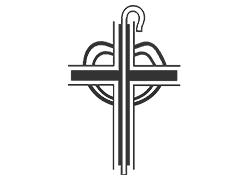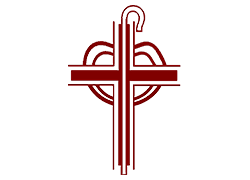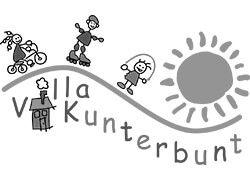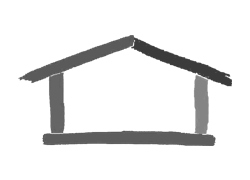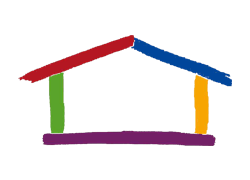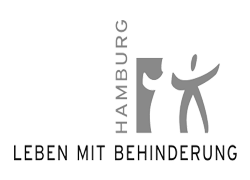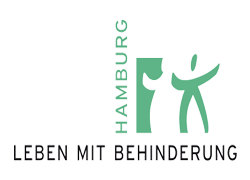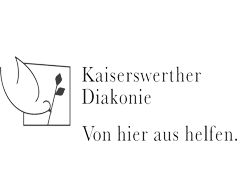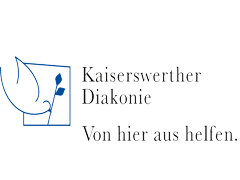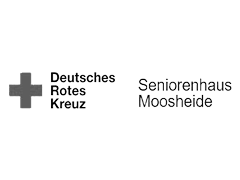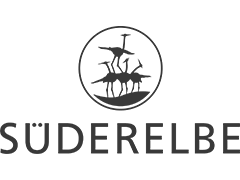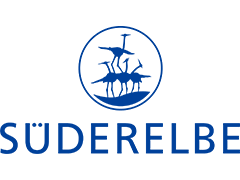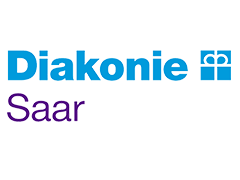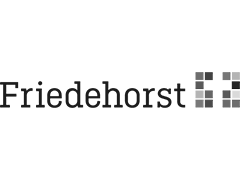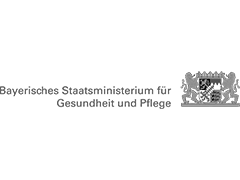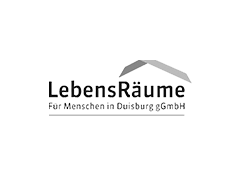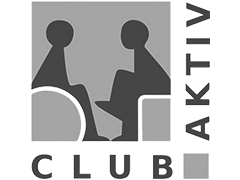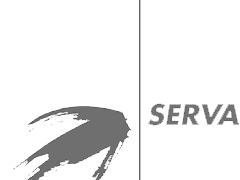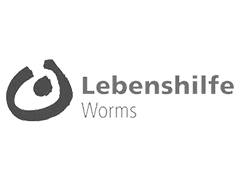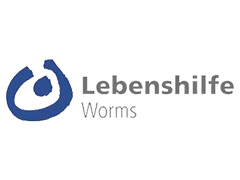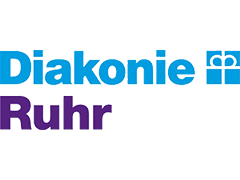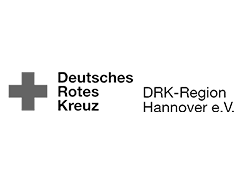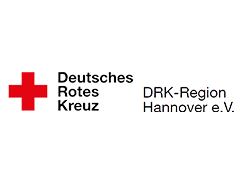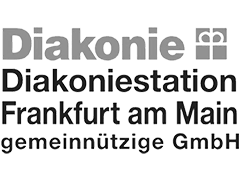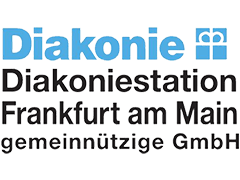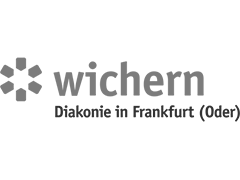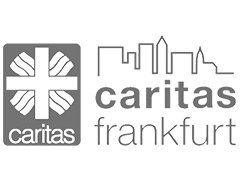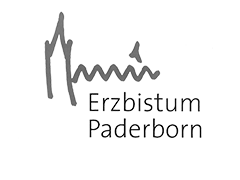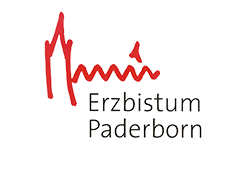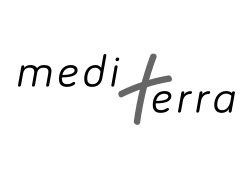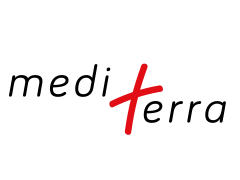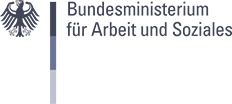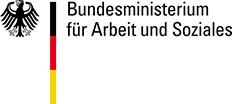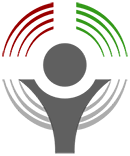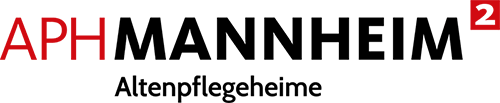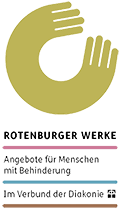„Wenn nicht wir, wer dann?“ Dieser Gedanke prägt das Selbstverständnis vieler Träger in der Sozialwirtschaft. Soziale Arbeit versteht sich als Menschenrechtsprofession – parteilich, solidarisch, engagiert. Sie setzt sich aus Überzeugung für die Würde und die Rechte benachteiligter Menschen ein und ermöglicht Teilhabe. Doch was, wenn dieser Anspruch an der wirtschaftlichen Realität scheitert?
Lange galt es als selbstverständlich, dass die soziale Daseinsvorsorge zu den Kernaufgaben des modernen Sozialstaats zählt und soziale Arbeit dementsprechend aus öffentlichen Mitteln finanziert wird. So entstand vor allem seit den 1970er Jahren bis in die 1990er Jahre ein starkes Netzwerk vielfältiger professioneller Hilfsangebote. Dieses „Goldene Zeitalter“ der sozialen Arbeit ist spätestens seit der Wiedervereinigung und der Krise der öffentlichen Kassen vorbei. Seitdem regiert der Rotstift und der öffentliche Diskurs kreist um die Zukunft des Sozialstaats in einer globalisierten Wirtschaft. Gleichzeitig nimmt die Komplexität der fachlichen Anforderungen zu und auch die personellen Spielräume werden immer enger.
Die Sozialwirtschaft agiert heute in einem Spannungsfeld: Auf der einen Seite steht der altruistisch-moralische Anspruch zu helfen, wo andere Systeme versagen. Auf der anderen Seite sehen sich Träger gezwungen, angesichts immer knapperer finanzieller Ressourcen, ihre Angebotslandschaft kritisch zu hinterfragen. Eine rein betriebswirtschaftliche Betrachtung greift hier zu kurz, denn sie löst nicht den tiefempfundenen emotionalen Druck: zu wissen, was nötig wäre, es aber unter den gegebenen Bedingungen nicht leisten zu können. Dennoch muss etwas passieren – weder eine hohe Moralisierung noch ein „Augen zu und durch“ helfen in der jetzigen Situation weiter.
Auf den ersten Blick klingt es hart, dennoch muss es klar gesagt werden: Zukünftig können nicht mehr alle Angebote und Dienstleistungen aufrechterhalten werden. Und das wird wiederum dazu führen, dass das Prinzip eines umfassend versorgenden Systems (leider) nicht mehr erfüllbar sein wird. Diese Entwicklung bedeutet für Klient*innen, dass sie auf gewohnte Angebote verzichten müssen und für Mitarbeiter*innen, dass sie das, was sie bislang getan haben, nicht mehr tun können. Dennoch muss der Anspruch bleiben, Angebote für besonders vulnerable Gruppen zu sichern.
Wenn die Frage, was beibehalten wird und was aufgegeben werden muss, nicht allein nach wirtschaftlichen Kennzahlen entschieden wird, wie kann dann verfahren werden? Einen Weg aus dem Dilemma bietet ein strategischer Entscheidungsprozess, der sowohl die moralische Verantwortung als auch die wirtschaftliche Realität berücksichtigt. Es gilt, das Angebotsportfolio systematisch zu durchleuchten und abzuwägen, ob die Leistungen in der bisherigen Art und Weise weiter fortgeführt werden sollen und können. Grundlage ist ein Kriterienkatalog, der eine 360-Grad-Betrachtung der Ist-Situation ermöglicht. Dieser nimmt neben wirtschaftlichen Fragen auch soziale, kulturelle, politische, personelle und ethische Dimensionen gleichberechtigt in den Blick.
Fachlich-inhaltlich:
Ethisch:
Personell:
Wirtschaftlich:
Wettbewerbsorientiert:
Anhand eines solchen Kriterienkatalogs lässt sich das vorhandene Leistungsportfolio übersichtlich darstellen und bewerten. Dies ist nicht nur eine solide Grundlage, um strategische Entscheidungen treffen zu können, sondern hat auch den weiteren positiven Effekt, die Entscheidungen für andere nachvollziehbar zu machen. Denn auch das muss von Anfang an mitgedacht werden: Veränderungen – insbesondere wenn bestimmte Angebote und Strukturen nicht mehr fortgeführt werden und wegfallen – stoßen bei den Beteiligten auf Abwehr und Frustration. Auch die Wirkung in der Öffentlichkeit darf nicht unterschätzt werden, wenn soziale Organisationen sich von Angebotsbereichen verabschieden. Umso wichtiger ist es, einen gut durchdachten Projekt- und Kommunikationsplan zu entwickeln, der die Effekte auf den verschiedenen Ebenen berücksichtigt.
Es sollte deutlich werden, dass es nicht das Ziel ist, „weniger“ zu machen, sondern dass es darum geht, „weniger, aber besser“ zu machen. Angesichts zunehmend knapper Ressourcen bleibt nur derjenige nach innen und nach außen handlungsfähig, der durch klare Differenzierung und Abgrenzung seine inhaltliche und gesellschaftliche Position profiliert und nachvollziehbar begründet.
Machen wir uns nichts vor: Ohne den politischen und gesellschaftlichen Willen, Gerechtigkeit und den sozialen Frieden zu erhalten, wird es nicht gehen. Die moralische Forderung an die Soziale Arbeit, dies allein zu leisten, reicht nicht aus. Es braucht eine gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Das Solidaritätsprinzip ist kein nostalgischer Wunsch, sondern die Grundlage unseres Sozialstaats und Voraussetzung dafür, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt und soziale Gerechtigkeit auch in Zukunft Bestand haben.
Aber dennoch müssen sich sozialwirtschaftliche Organisationen in Zukunft klarer positionieren, um weiterhin als sozial verantwortliche Akteure wahrgenommen zu werden. Eine Diskussion, die vorwiegend an Emotion und Moral appelliert, schafft auf Dauer Fronten. Es braucht deutlicher als bisher definierte und klar abgegrenzte Aufgabenfelder und Zielgruppen. Mit einer solchen Neupositionierung gelingt es Sozialunternehmen, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung auch künftig gerecht zu werden. Entscheidend ist dabei, die Balance zwischen „sozialen“ Zielsetzungen wie Gemeinwohl, Teilhabe und Impact auf der einen Seite und wirtschaftlichen Anforderungen wie Effizienz, finanzieller Stabilität und Marktlogik zu finden.
Text: Birgitta Neumann | Annette Borgstedt
© Shutterstock

Sie möchten Ihr Leistungsportfolio zukunftssicher ausrichten? Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir eine tragfähige Strategie, die Wirtschaftlichkeit und soziale Verantwortung in Einklang bringt. Sprechen Sie uns gerne an! Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.
contec - Gesellschaft für
Organisationsentwicklung mbH
Innovationszentrum Gesundheitswirtschaft
Gesundheitscampus-Süd 29
44801 Bochum
contec GmbH
Reinhardtstraße 31
10117 Berlin
contec GmbH
Sachsenstraße 20
20097 Hamburg
contec GmbH
Brienner Str. 45 a-d
80333 München
contec GmbH
Lautenschlagerstr. 23
70173 Stuttgart
contec - Gesellschaft für
Organisationsentwicklung mbH
Innovationszentrum Gesundheitswirtschaft
Gesundheitscampus-Süd 29
44801 Bochum
contec GmbH
Reinhardtstraße 31
10117 Berlin
contec GmbH
Sachsenstraße 20
20097 Hamburg
contec GmbH
Brienner Str. 45 a-d
80333 München
contec GmbH
Lautenschlagerstr. 23
70173 Stuttgart