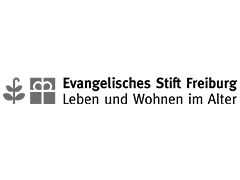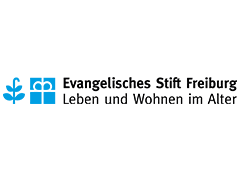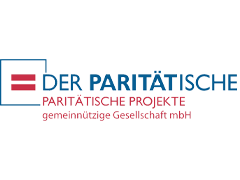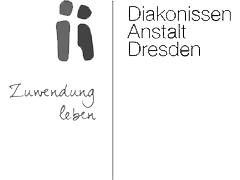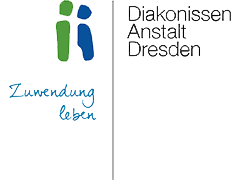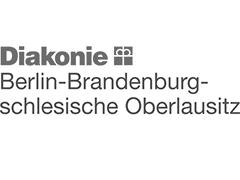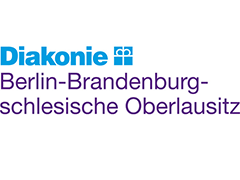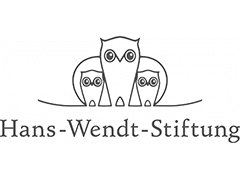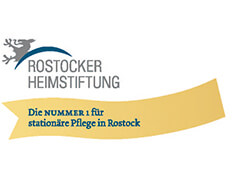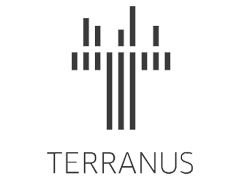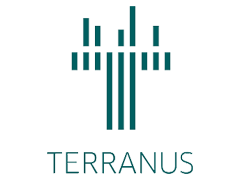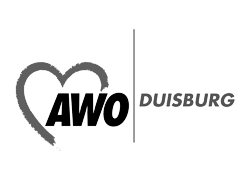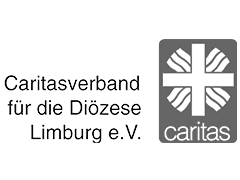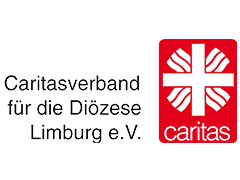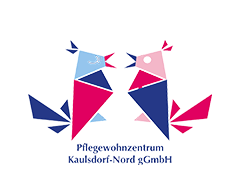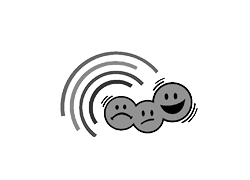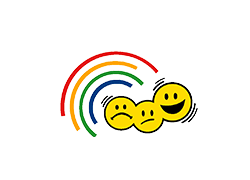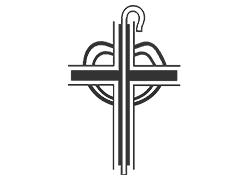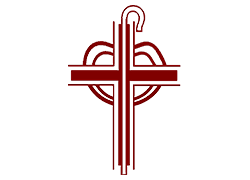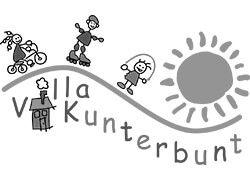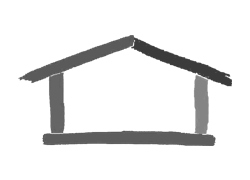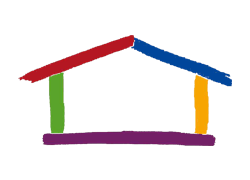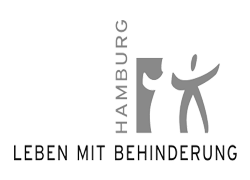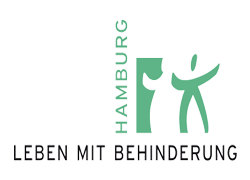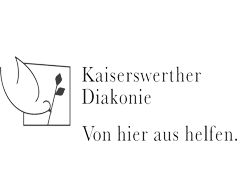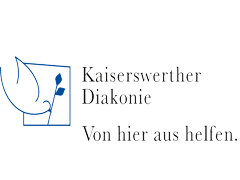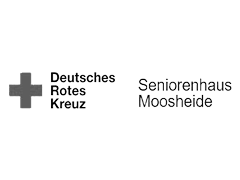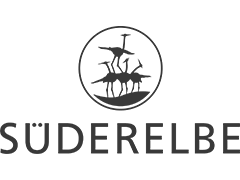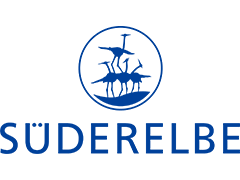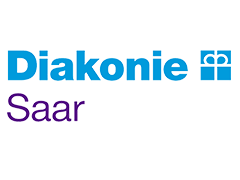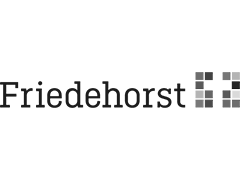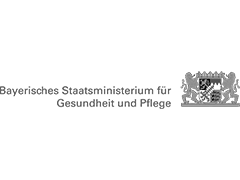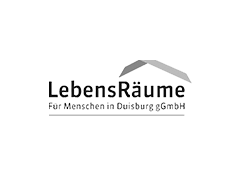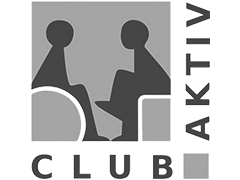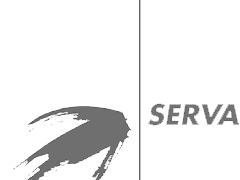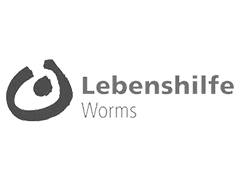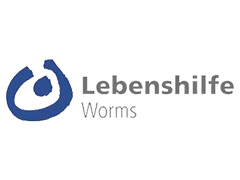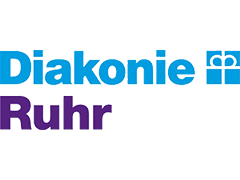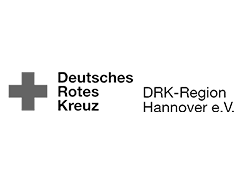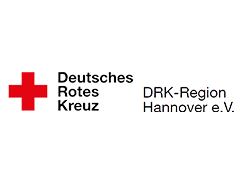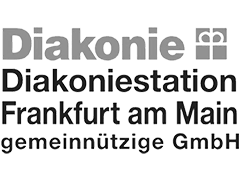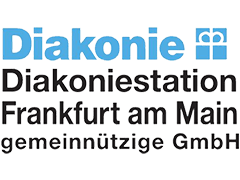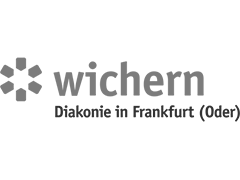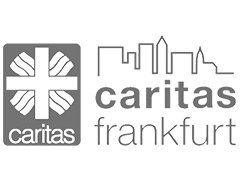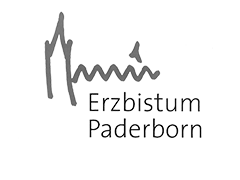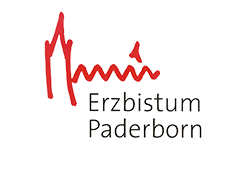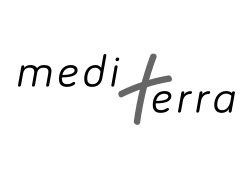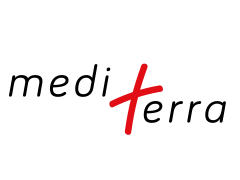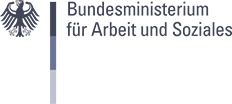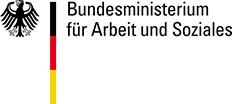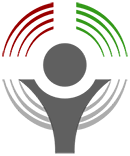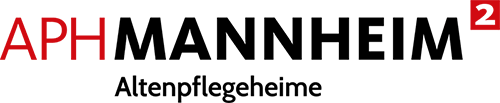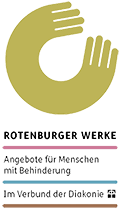Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) führt insbesondere in den Besonderen Wohnformen und den Intensiv betreuten Wohngruppen zu tiefgreifenden Veränderungen in der Leistungs- und Personaleinsatzplanung. Viele Organisationen haben jedoch noch kein klares Bild, wie sie Leistungen passgenau, wirksam und wirtschaftlich erbringen können. Das birgt erhebliche Risiken bis hin zu Regressforderungen durch die Leistungsträger. In diesem Beitrag zeigen wir, wie eine strukturierte Leistungs- und Personaleinsatzplanung gelingt.
Mit dem BTHG hat der Gesetzgeber die Eingliederungshilfe grundlegend reformiert: Das bisherige „Fürsorgesystem“ wurde zu einem modernen, personenzentrierten Teilhaberecht weiterentwickelt. Neu ist auch die sogenannte Wirkungsorientierung. So ist u.a. in den Regelungen zum Gesamtplanverfahren eine Wirkungskontrolle vorgesehen. Im Vertragsrecht der Eingliederungshilfe (Teil 2 des SGB IX) ist darüber hinaus geregelt, dass die Träger der Eingliederungshilfe und die Leistungserbringer Vereinbarungen zur Wirksamkeit von Leistungen in den Landesrahmenverträgen sowie den Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen treffen. Zusätzlich wurde ein gesetzliches Prüfrecht der Träger der Eingliederungshilfe hinsichtlich der Wirksamkeit von vereinbarten Leistungen eingeführt. Werden gesetzliche oder vertragliche Verpflichtungen nicht eingehalten, sieht das Gesetz eine Kürzung der vereinbarten Vergütung „für die Dauer der Pflichtverletzung“ (§ 129 SGB IX) vor.
Es reicht also nicht mehr aus, Leistungen pauschal zu erbringen. Sie müssen individuell zugeschnitten, wirksam und gut dokumentiert sein. Einrichtungen und Dienste in der Eingliederungshilfe müssen sicherstellen, dass die vertraglichen Leistungen
Nur wenn diese drei Ebenen konsequent umgesetzt und aufeinander abgestimmt sind, können Einrichtungen sowohl die gesetzlichen Vorgaben erfüllen als auch ihre wirtschaftliche Stabilität sichern.
Ohne Klarheit darüber, welche Leistungen tatsächlich erbracht werden müssen und welche nicht, und ohne Überblick, ob das richtige Personal mit der passenden Qualifikation zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, entstehen Ineffizienzen und wirtschaftliche Risiken.
Dienstplanung ist daher mehr als nur ein „Zeitplanungsinstrument“, das Dienste und Schichten abdeckt. Sie ist ein zentrales Steuerungsinstrument, um den organisatorischen und wirtschaftlichen Betrieb sicherzustellen. Ohne sie ist Wirkung auf individueller und Wirksamkeit auf struktureller Ebene nicht möglich.
Am Anfang steht der prüfende Blick auf das eigene Konzept sowie die Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen: Welche konkreten Leistungen wurden dort festgehalten – und welche nicht?
Im nächsten Schritt geht es darum, die individuellen und gemeinschaftlichen Bedarfe der Leistungsnehmer*innen zu erfassen: Welche individuellen Leistungen (einschließlich pflegerischer Bedarfe) sind erforderlich? Welche Wünsche und Bedarfe bestehen auf Gruppenebene? Welche Leistungen lassen sich gemeinschaftlich erbringen? Was gehört nicht (mehr) zum Leistungsangebot?
➡️ Wichtig: Prüfen Sie hier auch, ob die Leistungen korrekt und vollständig beantragt wurden.
Im dritten Schritt werden alle anfallenden Aufgaben strukturiert: Welche Tätigkeiten müssen von einer Fachkraft durchgeführt werden? Was können Nicht-Fachkräfte oder andere Berufsgruppen leisten? Was lässt sich durch Refinanzierung dritter (z. B. SGB V) an andere Anbieter delegieren? Welche kompensatorischen Leistungen können Hilfskräfte übernehmen?
Die Dienstplanung steht immer auch im Kontext rechtlicher, vertraglicher und betrieblicher Anforderungen. Dazu zählen u.a. Arbeitszeitgesetzte, tarifliche Vorgaben, Dienstvereinbarungen und Vorgaben der WTG-Behörden.
Nun kann mit den ermittelten Bedarfen und Strukturen ein Rahmendienstplan entwickelt werden, der auf Basis der Nettoarbeitszeit der Mitarbeitende folgende Leistungen sicherstellt:
Kurzfristige Personalausfälle lassen sich nicht vermeiden, wohl aber vorbereiten. Studien zeigen: Mitarbeiter*innen wünschen sich vor allem Verbindlichkeit in der Dienstplanung. Ein gut durchdachtes Ausfallmanagement fördert die Mitarbeitendenzufriedenheit und sichert die Leistungserbringung. Folgende Priorisierung hat sich bewährt:
So bleiben Pflege und Anwesenheit auch in Krisensituationen gewährleistet. Individuelle und gemeinschaftliche Assistenzen lassen sich im Bedarfsfall bündeln oder zeitlich verschieben.
Die Umstellung auf eine wirkungsorientierte und wirtschaftlich tragfähige Leistungs- und Personaleinsatzplanung ist anspruchsvoll und zeitintensiv. Sie erfordert nicht nur neue Prozesse und Strukturen, sondern auch ein Umdenken: Anstelle einer institutionellen Fürsorge stehen nun Personenzentrierung, Wunsch- und Wahlrecht sowie die selbstbestimmte Teilhabe im Mittelpunkt. Nicht mehr die Komplexleistungen einer Einrichtung bilden den Maßstab, sondern der einzelne Mensch mit seinen Wünschen und persönlichen Zielen. Das bringt Veränderungen mit sich – sowohl für die Mitarbeiter*innen als auch für die Leistungsempfänger*innen und ihre Angehörigen. Vieles wird erst einmal ungewohnt sein.
Damit die Neuausrichtung trotzdem gelingt, sollten alle Mitarbeiter*innen von Beginn an aktiv beteiligt und informiert werden. Die Umstrukturierung sollte unbedingt durch ein professionelles Projektmanagement begleitet werden. Transparenz, Dialog und realistische Zeitplanung sind zentrale Erfolgsfaktoren.
Der Aufwand lohnt sich: Eine verlässliche Dienstplanung verbessert nicht nur die Qualität der Leistungserbringung, sondern trägt zur Stabilität der wirtschaftlichen Situation und zur Minderung des Regressrisikos bei. Gleichzeitig fördert eine zuverlässige Schichtplanung die Work-Life-Balance und reduziert Stress. Zufriedene Mitarbeiter*innen sind motivierter, produktiver und weniger krankheitsanfällig – das verbessert langfristig die Personalbindung und steigert die Attraktivität als Arbeitgeber.
Darüber hinaus lassen sich durch eine gleichmäßige Verteilung von Aufgaben und gezielte Freiräume für pädagogische Assistenzleistungen Arbeitsprozesse optimieren. Eine regelmäßige Evaluation macht diese Fortschritte sichtbar und trägt zur kontinuierlichen Weiterentwicklung bei.
ℹ️ Vertiefen Sie Ihr Wissen in unserer Online-Seminarreihe „Fit in Zeiten des BTHG“
Erfahren Sie, wie Sie Dienstplanung, Leistungserbringung und Personaleinsatz wirksam und wirtschaftlich gestalten – rechtssicher, praxisnah und mit Blick auf Ihre Organisation.
Text: Barbara Telgen | Annette Borgstedt
Foto: © Freepik

Sie möchten Ihre Leistungs- und Dienstplanung neu aufstellen? Wir unterstützen Sie dabei, die Vorgaben des BTHG nicht nur zu erfüllen, sondern aktiv in wirtschaftlich tragfähige Strukturen zu überführen. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und vereinbaren Sie ein kostenfreies Erstgespräch.
contec - Gesellschaft für
Organisationsentwicklung mbH
Innovationszentrum Gesundheitswirtschaft
Gesundheitscampus-Süd 29
44801 Bochum
contec GmbH
Reinhardtstraße 31
10117 Berlin
contec GmbH
Sachsenstraße 20
20097 Hamburg
contec GmbH
Brienner Str. 45 a-d
80333 München
contec GmbH
Lautenschlagerstr. 23
70173 Stuttgart
contec - Gesellschaft für
Organisationsentwicklung mbH
Innovationszentrum Gesundheitswirtschaft
Gesundheitscampus-Süd 29
44801 Bochum
contec GmbH
Reinhardtstraße 31
10117 Berlin
contec GmbH
Sachsenstraße 20
20097 Hamburg
contec GmbH
Brienner Str. 45 a-d
80333 München
contec GmbH
Lautenschlagerstr. 23
70173 Stuttgart