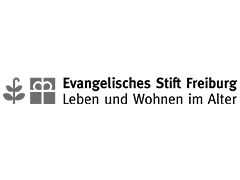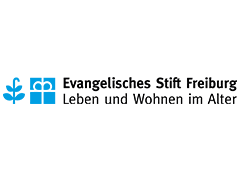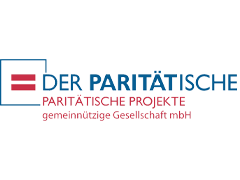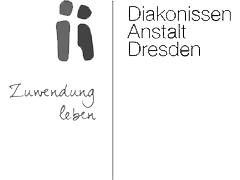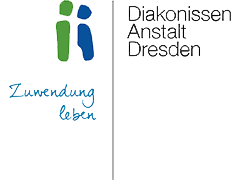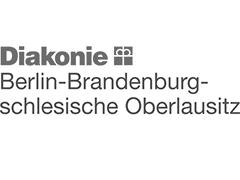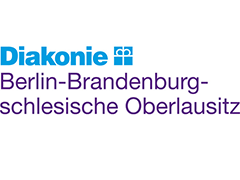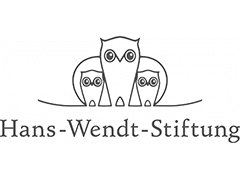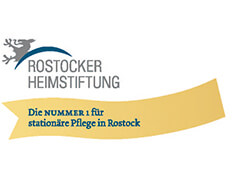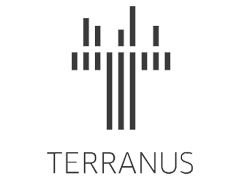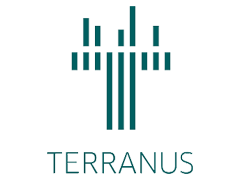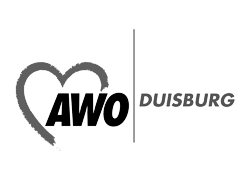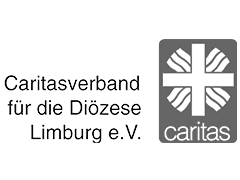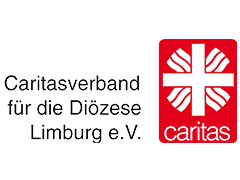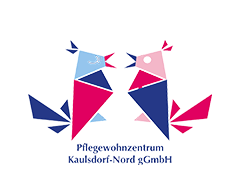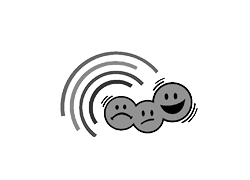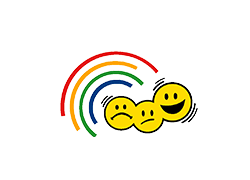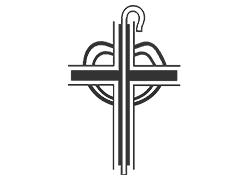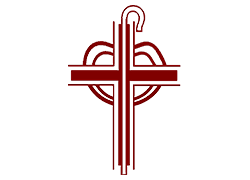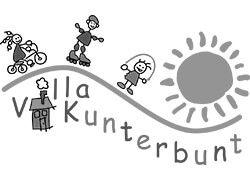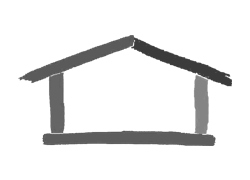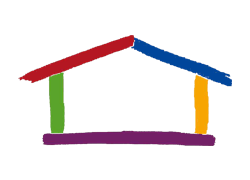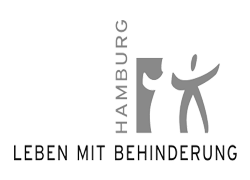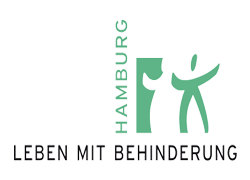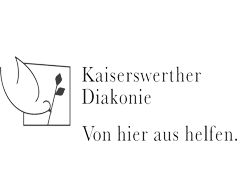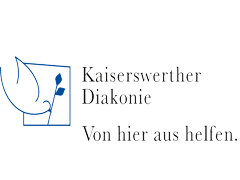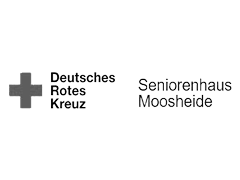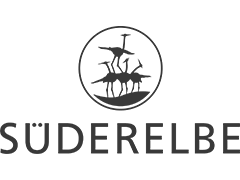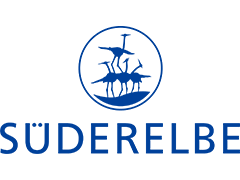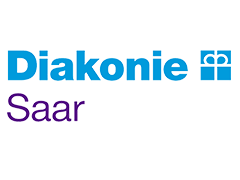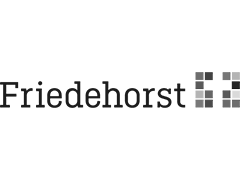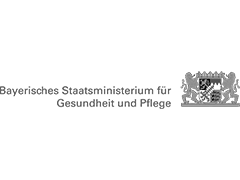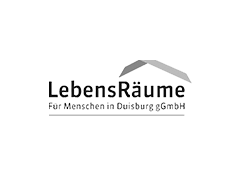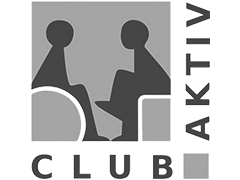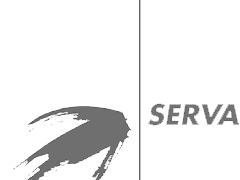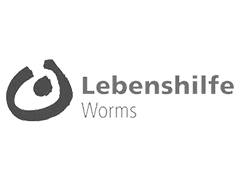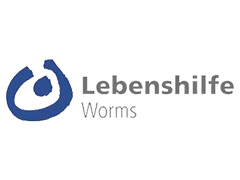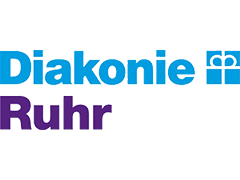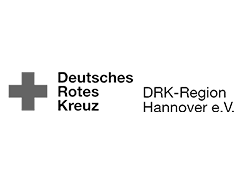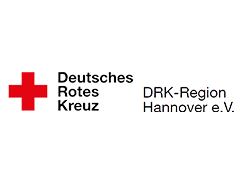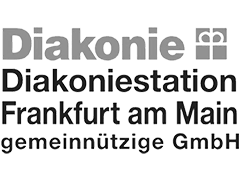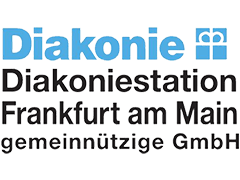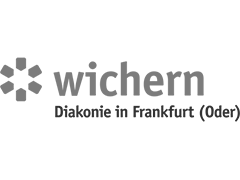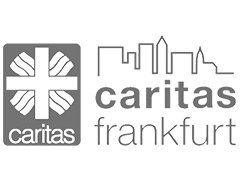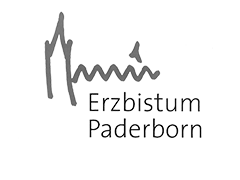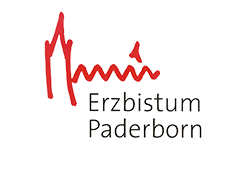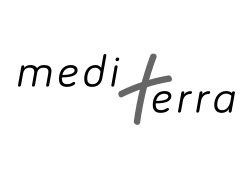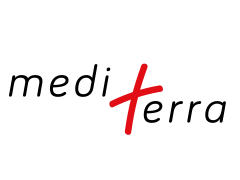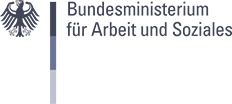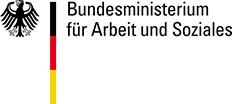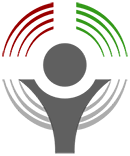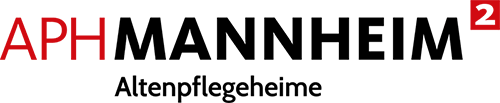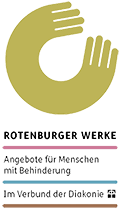Hohe Komplexität, wachsender Fachkräftemangels und tiefgreifende Transformationsprozesse stellen Führung in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft vor große Herausforderungen. In diesem Zusammenhang reicht alleiniges Management nicht mehr aus – es braucht Haltung. Daraus ergibt sich die Frage: Wie gelingt Führung, die strategisch wirksam ist und gleichzeitig menschlich bleibt?
Im Interview mit Dr. Thomas Müller, Geschäftsführer von contec und Leiter der Personalberatung conQuaesso® JOBS, sprechen wir über Führung in Krisenzeiten, strategische Nachfolgeplanung und Selbstreflexion als Ressource im Wandel. Dr. Thomas Müller berichtet aus seiner langjährigen Erfahrung im Spannungsfeld von Führung, Wandel und Systemdynamik sowie aus rund 1.000 Besetzungsverfahren im Top-Management der Branche. Für regelmäßige Erfahrungsberichte und Reflexionen rund um die Themen Führung, Strategische Nachfolgeplanung und Strategieberatung folgen Sie Dr. Thomas Müller bei LinkedIn.
Das Interview richtet sich an alle, die in der Verantwortung stehen, Wandel zu gestalten. Es liefert keine einfachen Führungs-Rezepte, sondern Impulse und Reflexionsanstöße zur Weiterentwicklung der eigenen Führungspraxis.
Herr Dr. Müller, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren intensiv mit Fragen rund um gute Führung. Was ist für Sie heute – inmitten tiefgreifender Transformationsprozesse – das entscheidende Kriterium für wirksames Leadership?
Führung ist für mich in erster Linie ein Resonanzraum. Es geht nicht darum, die richtigen Antworten zu haben, sondern gute Fragen an das System zu stellen – und ebenso an sich selbst. In einer Zeit, in der Planbarkeit abnimmt und Ambivalenzen zunehmen, braucht es Führungskräfte, die sich selbst reflektieren können, die Spannungen aushalten und Orientierung geben. Ich empfinde Selbstreflexion als große Ressource, denn meiner Erfahrung nach entwickelt man sein Führungsrepertoire nur durchs Lernen und Reflektieren weiter.
Einhergehend mit der Fähigkeit zur Selbstreflexion gibt es zudem ein weiteres Kriterium, das häufig unterschätzt wird: Konstruktives Feedback. Je höher jemand in einer Organisation steht, desto seltener bekommt er oder sie ehrliches, konstruktives Feedback. Räume zur Reflexion schaffen deshalb Entwicklungsmöglichkeiten jenseits von operativen Routinen – das sind z. B. projektunabhängige Austauschformate, Supervision oder kollegiale Beratung.
Die Gesundheits- und Sozialwirtschaft ist durch einige Spannungsfelder, wie z. B. Pflegequalität vs. Kostendruck oder Mitarbeiterbedürfnisse vs. Fachkräftemangel, geprägt. Viele Führungskräfte reagieren darauf mit dem Wunsch nach klaren Antworten. Doch was passiert, wenn es diese gar nicht gibt? In dem Zusammenhang sprechen wir von einer „Ambiguitätstoleranz“. Was bedeutet das konkret für Führung?
Ambiguitätstoleranz meint die Fähigkeit, Widersprüchlichkeiten und Unsicherheiten nicht nur zu ertragen, sondern produktiv zu nutzen. Theoretisch geht der Begriff auf Else Frenkel-Brunswik zurück (1951) und beschreibt eine psychologische Grundhaltung, die in komplexen Systemen wie der Gesundheits- und Sozialwirtschaft essenziell ist. Es geht darum, Widersprüche zu erkennen und zu integrieren und unter Unsicherheiten Entscheidungen treffen zu können. Ein Team gleichzeitig empathisch zu begleiten und konsequent zu führen, ist eben kein Widerspruch, sondern eine Kunst. Wenn Gewissheiten fehlen, gilt es das Vertrauen aufrechtzuhalten.
Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an ein Beispiel aus der Praxis. In einer Einrichtung hatte ein beliebter Mitarbeiter mehrfach gegen interne Dokumentationspflichten verstoßen – aus Überzeugung, dass Zeit am Menschen wichtiger sei. Die Führung entschied sich, die schwierige Entscheidung zwischen Kündigung, Abmahnung, oder sogar Belohnung offen zu halten. Das war zunächst unbequem, im Ergebnis entstand jedoch nach gemeinsamer Reflexion im Team ein angepasstes, teamgetragenes Dokumentationskonzept.
Eines Ihrer Fokusthemen ist die Strategische Nachfolgeplanung. Besonders in diesem Kontext ist das Thema „Loslassen“ für viele Führungskräfte ein zentrales. Warum ist es für viele eine Herausforderung, Verantwortung abzugeben?
Die Strategische Nachfolgeplanung ist eines der sensibelsten Themen im Führungskontext. Vor allem in unserer durch Identifikation und Sinnstiftung geprägten Branche geht es hierbei selten nur um einen strukturellen Prozess. Loslassen geht immer mit einem Kontrollverzicht einher und ist nicht selten auch mit Identitätsfragen verbunden. Eine gute Nachfolge bedeutet, sich selbst – zugunsten von Entwicklung – zurückzunehmen. Das erfordert Vertrauen in andere und in die eigenen Entscheidungen sowie eine Führungskultur, die eben diese Übergänge wertschätzt und nicht ausschließlich verwaltet.
Die Praxis zeigt: Wer strategische Nachfolgeplanung früh denkt, gewinnt an Klarheit und Kraft. Es geht darum, klare Kriterien für die Nachfolge zu definieren und dabei das erweiterte Leitungsteam einzubinden. Sprechen Sie vor der Nachbesetzung über Haltung, Potenziale und Werte, denn Strategische Nachfolge ist kein Projekt, sondern ein Reifungsprozess. Und schließlich: Nutzen Sie im Rahmen einer externen Begleitung die Möglichkeit zur Reflexion und Struktur sowie geeignete Schutzräume.
Wenn Sie auf die gegenwärtigen Herausforderungen im Gesundheits- und Sozialwesen blicken: Was macht Führung hier besonders anspruchsvoll und wie können Führungskräfte darauf reagieren?
Wir arbeiten in einem System, das zunehmend von Zielkonflikten geprägt ist: Wirtschaftlichkeit versus Menschlichkeit, Fachlichkeit versus Bürokratie, Sicherheit versus Innovation. In diesem Spannungsfeld verstehe ich Führungskräfte als gestaltende Akteur*innen, die Resonanz erzeugen. Das bedeutet nicht, täglich auf Knopfdruck gut gelaunt zu sein, um andere mit der eigenen Energie anzustecken. Vielmehr sollten Führungskräfte Räume schaffen, in denen Energie fließt – mal von oben nach unten, mal andersherum. Energie entsteht da, wo Menschen merken: Ich werde gesehen, gehört und kann gestalten.
Was mir außerdem wichtig ist zu sagen: Führung ohne Herausforderung wird schnell zu Verwaltung. Herausforderung, Entwicklung und Reibung gehören dazu und benötigen deshalb auch ihren Platz. Die Managementtheorie von Chris Argyris beschreibt treffend: Beim single-loop learning optimieren wir innerhalb bestehender Denkmuster. Beim double-loop learning hinterfragen wir die Grundlagen selbst – und kommen damit an die Substanz unserer Haltung. Dies ist essenziell für die eigene und die organisationale Weiterentwicklung und resümiert: Herausforderungen fordern uns, führen aber gleichzeitig zu notwendigen Entwicklungen.
Vielen Dank für Ihre Einblicke! Gibt es abschließend etwas, das Sie Führungskräften mitgeben können, um in dem komplexen Gefüge der Sozial- und Gesundheitswirtschaft zu navigieren?
Aus meiner Erfahrung heraus sind es vor allem drei Dinge, die zum (persönlichen) Erfolg beitragen:
1. Ein klares Bild davon, was man selbst verantwortet – und was nicht.
2. Rituale der Selbstreflexion und Regeneration.
3. Ein tragfähiges Netzwerk. Führung ist ein kollektives Geschehen, kein Alleingang.
Vielen Dank für das Gespräch, Dr. Thomas Müller!
Unser Lesetipp: In unserem Online-Magazin conZepte haben wir uns mit der Frage auseinandergesetzt, wie eine werteorientierte Führung die Mitarbeitergesundheit fördert. Hier gelangen Sie zum Artikel über werteorientierte Führung.
Redaktion: Leonie Hecken

Sie stehen vor der Herausforderung, Führung im Wandel zu gestalten oder eine Führungsposition neu zu besetzen? Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung in der Branche und sprechen Sie uns unverbindlich an.
contec - Gesellschaft für
Organisationsentwicklung mbH
Innovationszentrum Gesundheitswirtschaft
Gesundheitscampus-Süd 29
44801 Bochum
contec GmbH
Reinhardtstraße 31
10117 Berlin
contec GmbH
Sachsenstraße 20
20097 Hamburg
contec GmbH
Brienner Str. 45 a-d
80333 München
contec GmbH
Lautenschlagerstr. 23
70173 Stuttgart
contec - Gesellschaft für
Organisationsentwicklung mbH
Innovationszentrum Gesundheitswirtschaft
Gesundheitscampus-Süd 29
44801 Bochum
contec GmbH
Reinhardtstraße 31
10117 Berlin
contec GmbH
Sachsenstraße 20
20097 Hamburg
contec GmbH
Brienner Str. 45 a-d
80333 München
contec GmbH
Lautenschlagerstr. 23
70173 Stuttgart