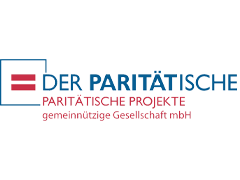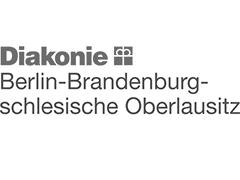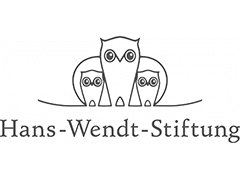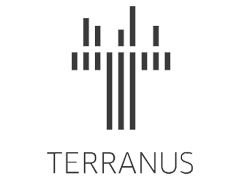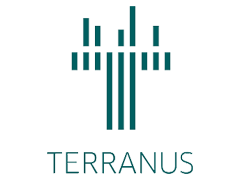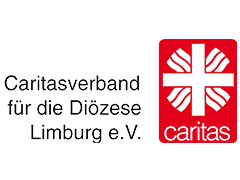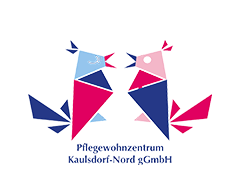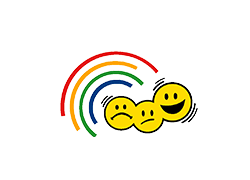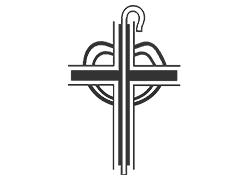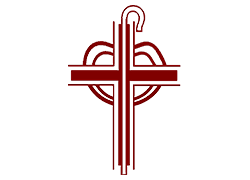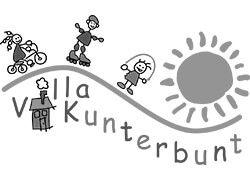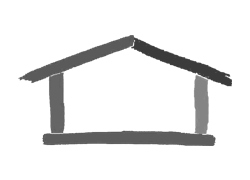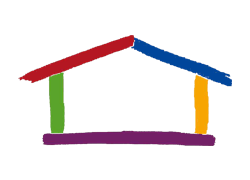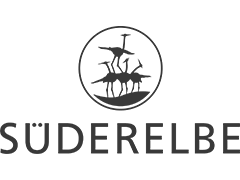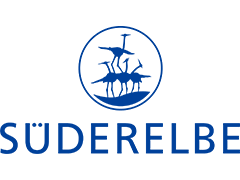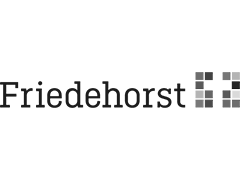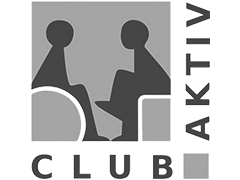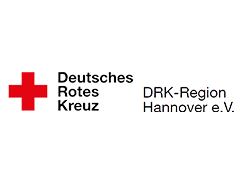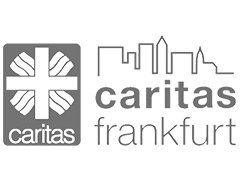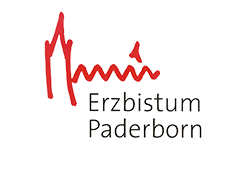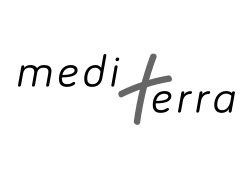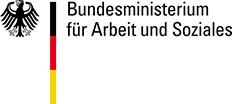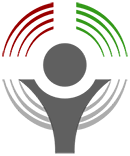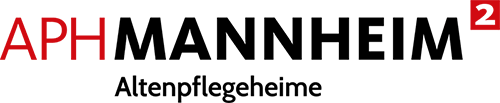Dr. Hasan Sürgit ist Vorstandsvorsitzender des DRK LV Westfalen-Lippe. Mit der Veröffentlichung „Digitalisierung als Erfolgsfaktor für das Sozial- und Wohlfahrtswesen“ hat er gemeinsam mit einigen Kollegen und Kolleginnen eine praxisnahe und -taugliche Grundlage vorgelegt, um das Thema der Digitalisierung in der Sozialwirtschaft voranzutreiben. Wir haben mit Dr. Sürgit darüber gesprochen, wie ein Digitalisierungsprozess in einem Sozialunternehmen aussehen kann, welche Faktoren es zu berücksichtigen gilt und welche Rahmenbedingungen sich dafür noch ändern müssen.
Herr Dr. Sürgit, Sie plädieren für die Digitalisierung in sozialen Organisationen – besser heute als morgen? Warum dieser Nachdruck?
Digitalisierung hat heute in der Sozialwirtschaft einen anderen Durchdringungsgrad als noch vor einigen Jahren. Wir reden ja nicht mehr von der klassischen IT, die immer reiner Support war. Wir reden hier davon, dass Digitalisierung zum Kundenprozess wird und die Kultur der Organisation sich entsprechend weiterentwickeln muss. Unsere Klienten und Klientinnen leben längst in einer digitalisierten Umwelt, gerade die Lebenswelt jüngerer Kundschaft ist geprägt von digitalen Kommunikationswegen wie Messengern. Die Qualität eines Leistungserbringers wird mehr und mehr an dessen Digitalisierungsgrad gemessen. Wollen soziale Unternehmen attraktiv für ihre Kundschaft bleiben, müssen sie die Vorteile der Digitalisierung nutzen – und zwar vom Kunden aus gedacht. Wie kommuniziert der Leistungserbringer mit mir? Wie gut sind die Angebote digital zugänglich und auffindbar? Unterstützt er mich bei meiner eigenen digitalen Teilhabe? Und so fort.
Sie sehen Digitalisierung also nicht nur als Mittel, um Prozesse effizienter zu gestalten, sondern vor allem als notwendig, um sich am Markt zu behaupten?

Dr. Hasan Sürgit
DRK Westfalen-Lippe
Natürlich. Denken Sie nur an die vielen Anbieter, die gerade in den ‚Markt‘ der sozialen Dienstleistungen strömen. Da kommen plötzlich Wettbewerber, die sich zwar in der Leistungserbringung selbst nicht unbedingt mit uns messen können, die aber die digitale Welt beherrschen, während manche soziale Traditionsunternehmen in ihren analogen Prozessen gefangen sind. Aber Digitalisierung steigert nicht nur die Attraktivität, sondern auch die Produktivität von Leistungen, wenn diese besser zu der Lebenswelt der Kundschaft passen. Digitale Teilhabe zu fördern muss bei Leistungserbringern weit nach oben auf der Priorisierungsliste klettern.
In Ihrem Buch stellen Sie auch die These auf, dass die Digitalisierung eines Sozialunternehmens nicht dem großen Masterplan folgen muss, sondern dass sie auch nach dem Prinzip Trial-and-Error erfolgen kann. Können Sie das erläutern?
Viele soziale Unternehmen verharren in einer Schockstarre, bis es eine große Strategie für den Change gibt, die es dann gleichzeitig in allen Organisationseinheiten abzuarbeiten gilt. Das lähmt m. E. den Prozess und wird den komplexen Strukturen unserer Branche nicht gerecht. Wir haben in der Sozialwirtschaft mit unterschiedlichen Rechtsformen zu tun, mit Mutter-, Tochter- oder Schwestergesellschaften, Vereinen etc. Hinzukommt ein komplexes Stakeholdermanagement, Kunden und deren Angehörige, Mitarbeitende, Politik, Kostenträger und Verwaltung. Ich glaube, es ist in diesen Strukturen sinnvoller, wenn man den einzelnen Organisationseinheiten mehr Freiheiten gibt, die Digitalisierung für die Erreichung ihrer Ziele und Teilziele zu nutzen, ihre Fehlerkultur entsprechend so aufzubauen, dass die positiven wie negativen Erfahrungen, die sie sammeln, der Gesamtorganisation zu Erkenntnis verhelfen. Digitalisierung ist ein dynamischer Prozess, Fehlermachen ist nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. Wichtig ist nur, dass die Grundlage stimmt. Das heißt, Unternehmensziele, die mithilfe der Digitalisierung erreicht werden sollen, müssen klar formuliert sein – sowohl für die Gesamtorganisation als auch für die kleineren Organisationseinheiten. Denn Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern dient immer der Erreichung von Zielen.
Was Sie beschreiben, eine Art Parallelität von mehreren Digitalisierungsprozessen innerhalb einer Organisation, setzt aber Vertrauen in die Organisationseinheiten und ein bestimmtes, modernes Verständnis von Führung voraus, oder?
Ja, es braucht Vertrauen, aber auch Befähigung. In der Sozialwirtschaft mit ihren Beratungsprozessen sind Ziele nicht so einfach zu definieren wie beispielsweise in Produktionsprozessen. Die Organisationseinheiten müssen befähigt werden, ihre Teilziele zu definieren und die Kennzahlen zu bestimmen, anhand derer sie diese messen bzw. mit welchen Instrumenten sie auch weiche Ziele messen wollen. Dem Management kommt die Rolle zu, die Stränge zusammenzuführen, vor allem die definierten Teilziele mit den übergeordneten Unternehmenszielen abzugleichen und die Erfüllung der Ziele zu kontrollieren. Bei uns im Verband haben wir dafür Gesprächskreise, Methodenworkshops und andere Austauschformate etabliert. Denn Kommunikation halte ich in dem Prozess für einen der wichtigsten Aspekte. Man muss sich ständig über die gemeinsamen Ziele und die Teilziele sowie deren Messbarkeit austauschen und reflektieren, warum welche Veränderung eingetreten ist oder eben nicht.
In Ihrem Buch haben Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen aus der Sozialbranche für die Umsetzung ein Phasenmodell vorgeschlagen. Darin steht unter anderem: Digitalisierung ist Chefsache, Kommunikation ist ein Erfolgsfaktor, es braucht die systematische Auseinandersetzung mit der Digitalisierung und mit der digitalen Reife des Unternehmens und weitere. Gibt es eine Phase, die Ihnen besonders wichtig erscheint?
Dieses Phasenmodell dient vor allem der Reduzierung der Komplexität bei dem Unterfangen, es geht um einen Operationalisierungsansatz. Letztlich ist keine Phase pauschal gesehen besonders wichtig. Im Vordergrund steht die Erkenntnis über die individuelle Status-Quo-Situation der eigenen Organisation und dann der Willensbildungsprozess, diese zu einem gewissen Ziel weiterzuentwickeln. Dann kann es helfen, sich einer Logik und Methodik zu bedienen, deren Auswahl von der jeweiligen Unternehmensstruktur abhängt. Wir haben uns bei unserem Modell an unseren Mitgliedsorganisationen orientiert und an einer Vielzahl von Erfahrungen von Verbänden und deren Situationen. Am Anfang stehen immer die Fragen: Wo steht die Organisation Stand jetzt? Wie hoch ist der Durchdringungsgrad der Digitalisierung bereits, was erwarten unsere Kunden, welche (finanziellen, personellen) Ressourcen sind verfügbar, haben wir schon eine Infrastruktur und sind unsere Mitarbeitenden bereit und fähig, den Prozess mitzutragen.
Mal angenommen, ein soziales Unternehmen hat den Erkenntnis- und Willensbildungsprozess hinter sich und hat die individuelle Situation reflektiert. Digitalisierung bedeutet immer auch Investition. Sehen Sie dafür schon die notwendigen Rahmenbedingungen gegeben – ich meine besonders mit Blick auf die Refinanzierung?
Nein, das ist genau die Krux. Die Sozialwirtschaft, insbesondere die freie Wohlfahrtspflege, ist schlichtweg nicht darauf ausgerichtet, Gewinne und Rücklagen zu schaffen, die für die Investition in die Digitalisierung aber dringend nötig wären. Die Refinanzierung der einzelnen Leistungsbereiche sieht in der Regel keine Investitionen oder die Errichtung von digitaler Infrastruktur vor oder gar die personellen Ressourcen, die es bräuchte. Das ist ein echtes Dilemma. Es wird von uns erwartet, unsere Organisationen zu digitalisieren, aber das soll parallel zum Tagesgeschäft und ohne größere Mehraufwendungen passieren. Das funktioniert nicht. Deshalb, glaube ich, ist uns bisher auch noch nicht der große Wurf gelungen, obwohl sich wirklich viele Organisationen im Rahmen ihres Möglichen auf den Weg gemacht haben.
Sehen Sie die Sozialpolitik in der Pflicht, die Rahmenbedingungen zu ändern?
Letztlich ja, mit dem Ziel, dass alle Beteiligten die gemeinsamen Probleme auch gemeinsam lösen, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit. Das Problem in der Sozialpolitik liegt nicht nur mit Blick auf die Digitalisierung darin, dass Reformen sich zu stark an dem Wählerwillen ausrichten und nicht an der Machbarkeit. So war es m. E. beim Bundesteilhabegesetz, das zu mehr Freiheiten für Menschen mit Behinderung führen sollte und jetzt ein bürokratisches Monstrum für alle Beteiligten ist, und so wird es auch mit der Pflegereform von Herrn Spahn sein, die zwar im Kern gute inhaltliche Ansätze hat, die aber nicht finanzierbar sein wird. Und so ähnlich ist es auch mit der Digitalisierung. Mir fehlt der ganzheitliche Blick darauf, für welche Probleme die Digitalisierung eigentlich die Lösung sein könnte. Wir könnten neue und bessere Teilhabeleistungen anbieten, könnten personelle Probleme lösen, die Zusammenarbeit stärken. Doch Politik wählt diesen ganzheitlichen Blick nicht. Da gehen uns enorme Potenziale verloren. Die Träger sich selbst zu überlassen, bringt nichts. Es geht ja hier um Leistungen aus den Sozialgesetzbüchern und nicht um klassische Konsumprodukte. Da braucht es eine gemeinsame Verpflichtung, aber eben auch die nötigen Rahmenbedingungen.
Jetzt hat Bundesgesundheitsminister Spahn ja mit seinem Gesetzentwurf zur digitalen Modernisierung von Versorgung und Pflege (DVPMG) einen gesetzlichen Rahmen gesteckt, der auch bestimmte digitale Anwendungen in die Regelversorgung integrieren soll, beispielsweise Apps zur Sturzprofilaxe oder Demenzprävention, aber auch die Telematik. Wie schätzen Sie das ein?
Es ist ein erster Schritt, gerade die Telematik bietet viele Potenziale. In der Städteregion Aachen haben wir ein sehr erfolgreiches Modellprojekt für einen Telemedizinischen Rettungsdienst gefahren, der aus der Not heraus entstanden ist – wir hatten zu wenige Notärzte – und jetzt in die Regelversorgung übernommen wurde. Auch die Videosprechstunde ist für die Versorgung Pflegebedürftiger auf dem Land sehr vielversprechend. Wie das Gesetz dann in der Umsetzung aussieht, bleibt aber noch abzuwarten. Wichtig ist dann auch, dass die Politik den Zugang zu einem digitalen Markt sozialer Dienstleistungen ein Stück weit reguliert. Denn es ist zu erwarten, dass Plattformmodelle, wie es sie heute schon gibt, aus dem Boden schießen werden und da darf es keine Benachteiligungen geben. Die eigentliche Wertschöpfung darf nicht nur auf den Plattformen stattfinden. Es geht hier um Dienstleistungen, die aus Steuergeldern finanziert werden, und nicht um Bücher oder Ferienwohnungen.
Ein Thema haben wir noch nicht angesprochen: Das Personal und welche Rolle die Digitalisierung im Fachkräftemangel einnimmt…
Ja, auch in dieser Diskussion fehlt mir ein ganzheitlicher Blick. Oft geht es darum, dass man sich als soziale Organisation digitalisieren sollte, um für die jungen Generationen attraktiv zu sein und im Kampf um Fachkräfte nicht zu verlieren. Aber es ist eine demografische Tatsache, dass wir zu wenige Menschen in allen Bereichen der Wirtschaft haben werden. In der Sozialwirtschaft werden wir nur zukünftig noch mehr brauchen, weil den wenigen jungen, arbeitsfähigen Menschen immer mehr alte Menschen oder Menschen mit Hilfebedarf gegenüberstehen. Also sollten wir den Blick doch ausweiten auf die Frage: Wo kann Digitalisierung uns helfen, die menschlichen Ressourcen zu schonen? Hier brauchen wir eine Systematik, die Fragen nach neuen Organisationsmodellen, nach Substituten im Arbeitsalltag (Robotik, KI, Assistenzsysteme etc.), Digitalisierung als Thema und als Hilfsmittel in der Ausbildung und vieles mehr kombiniert. So haben wir nicht nur die Chance, attraktiver zu sein, sondern auch effizienter. Und darum geht es ja: Die Lücke, die auf jeden Fall klaffen wird, so gut es geht zu schließen. Und da, wo nicht genügend Menschen sind, um diese zu schließen, muss man versuchen, die Fachkräfte, die man hat, für die Kernarbeit, die soziale Dienstleistung am Menschen, zu entlasten. Digitalisierung bietet hier viele Chancen. Was wir brauchen, ist die Sozialpolitik, die ihrer Verantwortung in dem Sinne nachkommt, dass Sie alle Beteiligten, Kostenträger und Leistungserbringer, aber natürlich vor allem Interessenvertretungen der Leistungsberechtigten, an einen Tisch holt und man gemeinsam transparente und nachvollziehbare Lösungen entwickelt – so wird die Akzeptanz für umfassende Veränderungen auch viel höher sein. Mir ist durchaus bewusst, dass dies ein komplexes Unterfangen ist, und deshalb gilt es auch jetzt schon, das, was möglich ist, zu realisieren.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Sürgit!
Text: Marie Kramp
Sie suchen die passende Führungskraft für den digitalen Wandel in Ihrem Unternehmen? Sprechen Sie uns unverbindlich an!
contec - Gesellschaft für
Organisationsentwicklung mbH
Innovationszentrum Gesundheitswirtschaft
Gesundheitscampus-Süd 29
44801 Bochum
contec GmbH
Reinhardtstraße 31
10117 Berlin
contec GmbH
Sachsenstraße 20
20097 Hamburg
contec GmbH
Brienner Str. 45 a-d
80333 München
contec GmbH
Lautenschlagerstr. 23
70173 Stuttgart
contec - Gesellschaft für
Organisationsentwicklung mbH
Innovationszentrum Gesundheitswirtschaft
Gesundheitscampus-Süd 29
44801 Bochum
contec GmbH
Reinhardtstraße 31
10117 Berlin
contec GmbH
Sachsenstraße 20
20097 Hamburg
contec GmbH
Brienner Str. 45 a-d
80333 München
contec GmbH
Lautenschlagerstr. 23
70173 Stuttgart