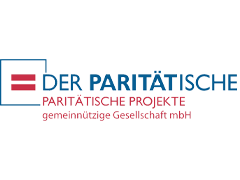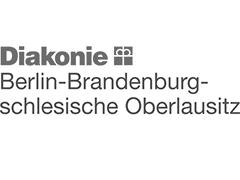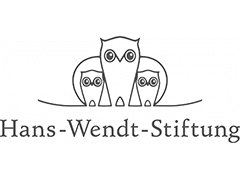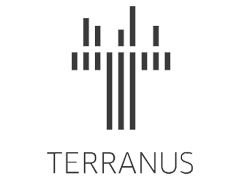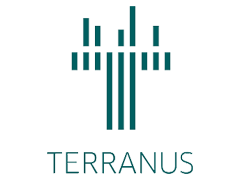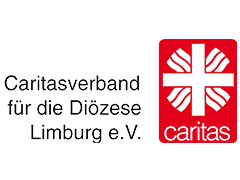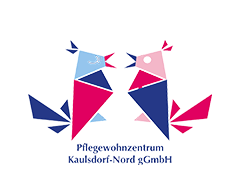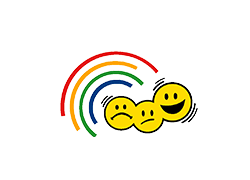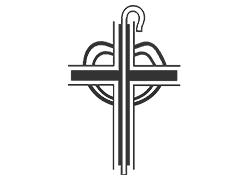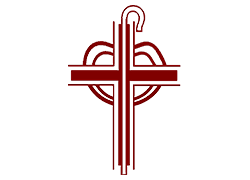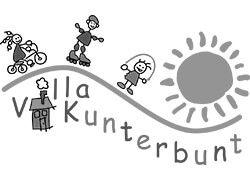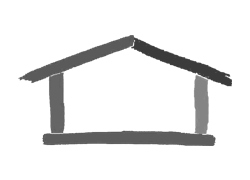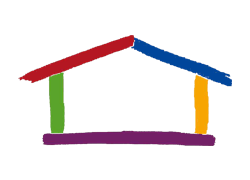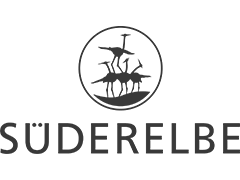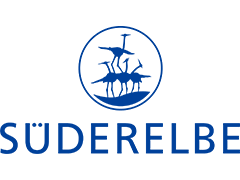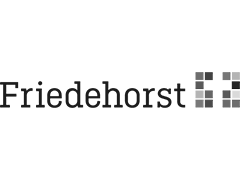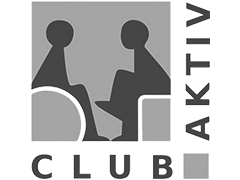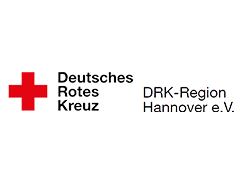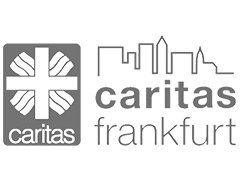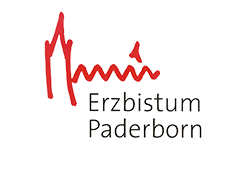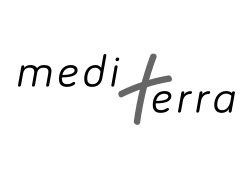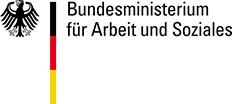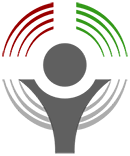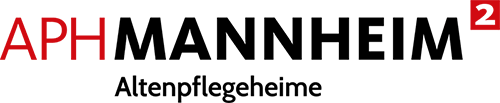Teil I Führen in der Krise: Auch wenn der Krisen-Modus aufgrund der Corona-Pandemie mittlerweile seit einigen Wochen andauert und ein Alltag in der Krise stattfindet – eine unsichtbare Gefahr wie eine Pandemie macht etwas mit unserer Psyche, sie fördert Verhaltensweisen zutage, die neu sind und löst Dynamiken aus, die scheinbar schwer zu kontrollieren sind. Als Auftakt unserer Reihe „Führen in der Krise“ haben wir mit Monika Puls-Rademacher, Diplom-Psychologin und externe Managementberaterin bei contec, über die psychologischen Auswirkungen der Krise und den Umgang damit in sozialen Einrichtungen gesprochen.
Frau Puls-Rademacher, was löst eine Krise wie die aktuelle Corona-Pandemie- bei uns Menschen auf psychologischer Ebene aus?
Zunächst einmal handelt es sich bei einer Pandemie um eine sehr reale und gleichzeitig auch um eine sehr abstrakte Gefahr. Wir sehen nichts, wir fühlen nichts und dennoch wird uns ständig suggeriert, dass wir nicht mehr vor die Tür gehen dürfen, weil „der Tiger schon im Eingang sitzt“. Diese versteckte und gleichzeitig allgegenwärtige Gefahr ist für uns Menschen schwer einzuordnen; entsprechend haben wir kaum eine Idee, wie wir damit umgehen sollen. Und so individuell wie wir alle sind, so individuell reagieren wir auch auf diese Bedrohung. Während die einen mit dem Gefühl absoluter Hilflosigkeit reagieren und sich in ihr Schneckenhaus zurückziehen, haben andere den Eindruck, dass die Lage beherrschbar ist und sie aktiv eine Verbesserung der Situation herbeiführen können. Wieder andere warten ab, weil sie die Flut an Informationen noch nicht einordnen können und es ihnen daher nicht möglich ist, einen gangbaren Weg zu skizzieren. Eine Krise bedeutet für uns Menschen auch immer Stress: die Hormone Cortisol und Adrenalin werden freigesetzt und wir sind plötzlich zu außergewöhnlichen Leistungen in der Lage: Kampf oder Flucht – das waren die Alternativen in grauer Vorzeit, dafür sind wir körperlich gerüstet! Für den Fall, dass Kampf und Flucht nicht erfolgversprechend waren, haben wir uns totgestellt, in der Hoffnung, dass die Gefahr an uns vorbeizieht. „Nichts tun, zum eigenen Schutz“ war aber das letzte Mittel, wenn die Gefahr übermächtig, der Tiger also zu groß und zu schnell war. Denn totstellen hatte eine gute Chance schief zu gehen! Heute wissen wir, dass Menschen eine Krise besser überstehen, wenn sie handlungsfähig bleiben und zur Verbesserung ihrer Lage beitragen können. Stresshormone geben uns allen die Voraussetzungen, hoch aktiv und wirksam zu handeln. Dies gilt es zu unser aller Vorteil zu nutzen.
Wie sieht das in Pflegeeinrichtungen aus, wo Mitarbeitende ja einem besonderen Risiko ausgesetzt sind und gleichzeitig auch mit der Hochrisikogruppe arbeiten?
Das Pflegeheim als eine Art Mikrokosmos bringt natürlich ähnlich unterschiedliche Reaktionen auf Mitarbeiterebene hervor, wie wir sie in der gesamten Gesellschaft vorfinden.
Da gibt es zunächst eine große Gruppe derer, die unsicher sind und nicht wissen, woran sie sich orientieren sollen. Die Flut der Kommunikation in den Medien trägt in solchen Fällen meist nicht dazu bei, eine klare Linie zu erkennen, so dass viele Menschen eher verunsichert sind. Diese Gruppe orientiert sich z. B. an der Führungskraft, sie ist überaus dankbar für klare Strukturen und Regeln und für einen Plan, denn das gibt Halt und man fühlt sich geschützt.
Daneben gibt es fast immer eine zweite kleinere Gruppe derer, die aus der Krise Tatendrang schöpfen und voller Energie und Optimismus loslaufen und handeln. Das kann in der Praxis so aussehen, dass ein paar Pflegekräfte zu neuer Höchstform auflaufen, eigenständig Balkonkonzerte organisieren, in Gruppen Mund- und Nasenmasken nähen oder sich mehr mit der Digitalisierung auseinandersetzen, um Bewohner*innen eine Interaktion mit ihren Angehörigen zu ermöglichen. Ist die Aktionsgruppe hoch motiviert bei der Arbeit wirkt das sehr schnell mitreißend auf die Gruppe der noch unentschlossenen, die nun Sinn und Nutzen des aktiven Handelns erkennen kann.
Freilich gibt es auch eine kleine Gruppe derer, die Hoffnungslosigkeit angesichts der Gefahr verspüren, sich mutlos zurückziehen und sich „vorsichtshalber“ krankmelden.
Was mache ich als Führungskraft mit dem Wissen um diese verschiedenen Gruppen?
Zunächst einmal ist es wichtig, zu wissen, dass Angst und Hilflosigkeit psychologisch – ähnlich wie ein Virus – ansteckend auf andere Mitarbeitende wirken können. Die gute Nachricht: Das können Zuversicht und Optimismus auch! Es gilt also, als Führungskraft das Hauptaugenmerk auf die Gruppe der Mitarbeitenden zu richten, die aus der Krise Kraft schöpfen und mit einer Vielzahl von Ideen beherzt vorangehen. Diese task force unterstützt die Führungskraft in der Krisensituation, weil sie zuversichtlich und handlungsfähig bleibt und vielleicht bald erste Erfolge verzeichnet. Allerdings ist es manchmal eine Herausforderung für Führungskräfte, diese Gruppe so zu steuern, dass alle Aktionen zielführend sind und sich in die Gesamtstrategie der Organisation einbetten. Dafür bietet eine solche task force dann Orientierung für Unentschlossene und Optimismus für Mutlose. Das sollte seine Wirkung nicht verfehlen und uns große Teile dieser Gruppen wieder an Bord holen.
Welche Bedürfnisse muss ich bei den Mitarbeitenden der Pflege in der Krise beachten?
Mitarbeitende aller drei geschilderten Gruppen haben immer ein Bedürfnis nach Orientierung und Transparenz. Damit kommt der Führung und ihrer Kommunikation in Krisenzeiten eine besonders hohe Bedeutung zu! Gefühle akzeptieren, Zuversicht vermitteln, eine Strategie entwickeln und planvoll vorgehen sind wichtige Elemente der Führung, auch wenn dabei improvisiert werden muss. Ich fasse das gerne wie Faye Wattleton in dem Satz zusammen: „The only safe ship in a storm is leadership“. Noch etwas kommt hinzu: Wurden wir einmal von einem katastrophalen Sturm erfasst und tauchen wieder auf, dann ist unsere erste Frage „Wie beschädigt bin ich? Wenn wir feststellen, dass die Situation zum Überleben ausreicht, folgt sofort die zweite wichtige Frage: „Wo sind die anderen und wie geht es ihnen?“ Wir haben offensichtlich ein tief verwurzeltes Wissen, dass wir eine Krise am besten in Gemeinschaft meistern. Die Herausforderung für Führungskräfte ist es nun, auch unter erschwerten Bedingungen, Interaktion und Teamgeist zu fördern. Welche Formen des Miteinanders sind also mit welchen Sicherheitsvorkehrungen möglich? Ein Brainstorming via Videokonferenz oder ein Austausch der Kleingruppe im großen Konferenzraum? Ohne Austausch und Zusammenarbeit mit anderen fehlt uns das entscheidende Gegenüber, das uns unsere Wirksamkeit und die Effektivität unseres Handelns spiegelt. Darauf sind wir in der Krise besonders angewiesen, es bringt uns die nötige emotionale Sicherheit, das Richtige zu tun.
Was sagen Sie Betreibern von sozialen Einrichtungen, wenn sie Angst vor einer Lähmung durch die Krise haben?
Eine rein psychologisch bedingte Lähmung der gesamten Mitarbeiterschaft ist sehr unwahrscheinlich. Selbst in schlimmsten Katastrophenszenarien stecken die Menschen in der Regel nicht geschlossen den Kopf in den Sand. Dazu ist das Bestreben nach Sicherheit zu groß. Es gilt allerdings, die richtigen Strategien zu finden, das Potenzial der Krise zu nutzen und mit Mut und Zuversicht handlungsfähig zu bleiben, auch wenn dabei improvisiert werden muss. Das gehört in der Krise dazu
Vielen Dank für das Gespräch, Frau Puls-Rademacher!
Text: Marie Kramp
Sie haben Fragen rund um die Personalführung in Krisenzeiten? Ob während Corona oder danach, sprechen Sie uns unverbindlich an!
contec - Gesellschaft für
Organisationsentwicklung mbH
Innovationszentrum Gesundheitswirtschaft
Gesundheitscampus-Süd 29
44801 Bochum
contec GmbH
Reinhardtstraße 31
10117 Berlin
contec GmbH
Sachsenstraße 20
20097 Hamburg
contec GmbH
Brienner Str. 45 a-d
80333 München
contec GmbH
Lautenschlagerstr. 23
70173 Stuttgart
contec - Gesellschaft für
Organisationsentwicklung mbH
Innovationszentrum Gesundheitswirtschaft
Gesundheitscampus-Süd 29
44801 Bochum
contec GmbH
Reinhardtstraße 31
10117 Berlin
contec GmbH
Sachsenstraße 20
20097 Hamburg
contec GmbH
Brienner Str. 45 a-d
80333 München
contec GmbH
Lautenschlagerstr. 23
70173 Stuttgart