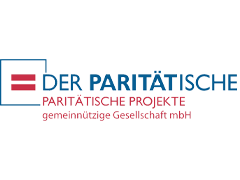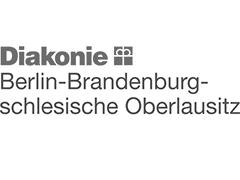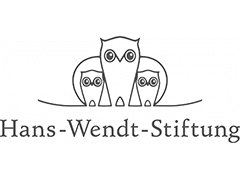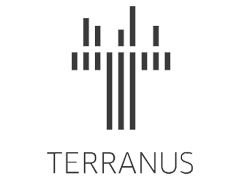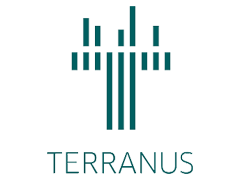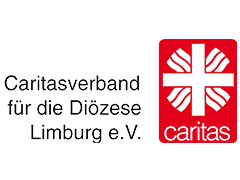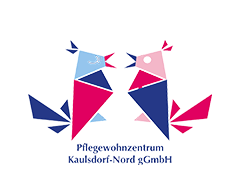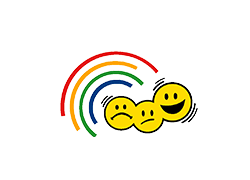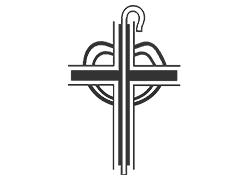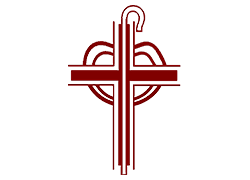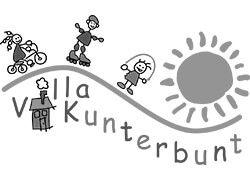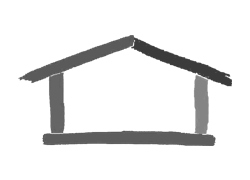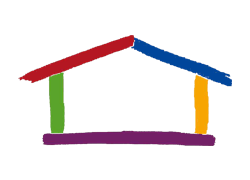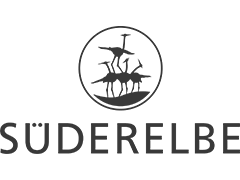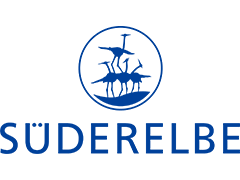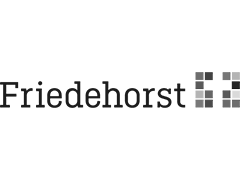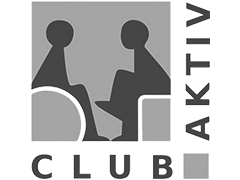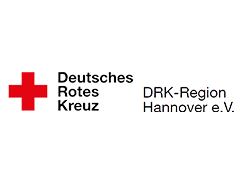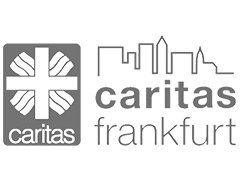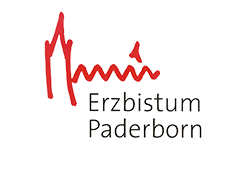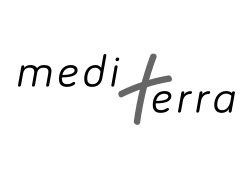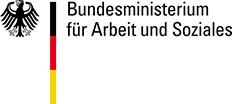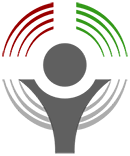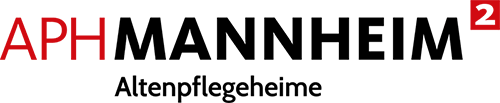Unter der Leitfrage „Wie macht man Teilhabe?“ hat die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen sich für die modellhafte Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zusammengetan und gezielt mit Begleitung der contec die Umwandlung von stationär zu ambulant in ehemaligen Wohnheimen für Menschen mit Behinderung vorangetrieben. Ende 2020 erschien die Arbeitshilfe zu dem Projekt, die anderen Einrichtungen der Eingliederungshilfe eine Handreichung für die Umsetzung personenzentrierter Leistungserbringung sein soll. Wir haben uns mit Kristin Schetat vom CJD Erfurt, einer von drei Modelleinrichtungen des Projekts, über die vielversprechenden Ergebnisse unterhalten.
Das Projekt „Wie macht man Teilhabe?“ startete 2017 als Gemeinschaftsprojekt zur Umsetzung der Personenzentrierung in allen Leistungsbereichen der Eingliederungshilfe – auch beim Wohnen – die das BTHG fordert. „Die Umwandlung des stationären Sektors stellt eine besonders große Herausforderung dar, wenn man das Ziel ernst nimmt“, so Kristin Schetat, Fachbereichsleiterin Wohnen und Begleiten des CJD Erfurt. „Kunden und Kundinnen, die seit Jahren und Jahrzehnten das stationäre Setting gewohnt sind, aber auch Mitarbeitende, die in einem Fürsorge-System gelernt und gearbeitet haben, auf die personenzentrierte Leistungserbringung vorzubereiten, bedarf eines umfassenden Partizipations- und Entwicklungsprozesses aller Beteiligten und viel Raum für ihre Sorgen und Ängste.“ Ziel war es, die drei ehemals stationären Einrichtungen vom CJD Erfurt, der Lebenshilfe Weimar-Apolda und dem Bodelschwingh-Hof Mechterstädt in ambulante Wohnangebote umzuwandeln. Alle drei hatten unterschiedliche Voraussetzungen und sind individuelle Wege gegangen, aber im Projekt gab es immer wieder Treffen und Austausch zu den Fortschritten und den Erfahrungen, die insbesondere für die Kundinnen und Kunden wertvoll waren, aber auch für die Projektumsetzung an sich. „Das Projekt und die gemeinsame Arbeit waren unglaublich hilfreich. Eine eigenständige Umsetzung der Ambulantisierung einer besonderen Wohnform wäre auch denkbar gewesen, zumal das Interesse bei Projektanfrage von Leistungsträgerseite sehr groß war. Aber dann wären noch einmal ganz andere Steine im Weg gewesen“, so Kristin Schetat. Außerdem habe ein Projekt wie dieses ein viel größeres Sprachrohr, als wenn einzelne Träger sich um die Umsetzung des BTHG bemühen. „Wir konnten Öffentlichkeit gewinnen und so über das BTHG hinaus auf das Thema Teilhabe aufmerksam machen, was meines Erachtens noch viel zu wenig passiert, dafür, dass wir immer von einem Paradigmenwechsel sprechen“, ergänzt die Fachbereichsleiterin.

Kristin Schetat
CJD Erfurt
Die Modell-Einrichtung des CJD war ursprünglich eine an ein Wohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung angegliederte Außenwohngruppe. Zehn Personen bewohnten in einem Mehrfamilienhaus drei von vier Etagen. Weil den Bewohner*innen ihre jeweiligen Wohngemeinschaften über die Jahre sehr ans Herz gewachsen waren, sollten diese in der Form bestehen bleiben – so der ausdrückliche Wunsch der Personen. Für den ersten Schritt weg von statinoär hin zu ambulant waren also keine baulichen Maßnahmen und Umzüge nötig, aber der Vermieter schloss neue Mietverträge direkt mit den Bewohner*innen des Hauses. In einem zweiten Schritt wurden die Teilhabeleistungen angepasst. Diese werden jetzt nicht mehr pauschal und in Gruppen, sondern in ihrem privaten Wohnumfeld erbracht und damit als ambulante qualifizierte Assistenzleistungen personenzentriert ausgerichtet. Der Kritik einer „Schein-Ambulantisierung“ hält Kristin Schetat entgegen: „Es war der ausdrückliche Wunsch der Bewohner*innen, an der gemeinsamen Wohnstruktur festzuhalten. Personenzentrierung heißt ja gerade, diese Wünsche auch genauso zu akzeptieren. Außerdem haben wir die Präsenzdienste eingestellt und nur noch über ein Bezugsbetreuersystem mit eins-zu-eins-Fokus und ambulanten Touren gearbeitet und zusätzlich den Bereich des SGB XI eröffnet.“ Zudem habe nach ca. einem Jahr nach der Umstellung von stationär auf ambulant auch die Heimaufsicht bestätigt, dass es sich bei den Wohngemeinschaften um selbstständig organisiertes Wohnen handelt, das keinem Setting einer besonderen Wohnform angegliedert ist.
Obwohl das Projekt durch die örtlichen Leistungsträger mit initiiert wurde, um am Ende auch zu sehen, wie personenzentrierte Komplexleistungen aussehen und verhandelt werden können, stoßen die Beteiligten auf ein entscheidendes Hindernis: „Bei der Umstellung auf eine personenzentrierte Komplexleistung dürfen wir nicht vergessen, dass das mehr als ein bürokratischer Akt ist. Hier geht es darum, Menschen, die über Jahre und Jahrzehnte nicht gelernt haben, wichtige Entscheidungen für sich selbst zu treffen, auch zu der entsprechenden Mündigkeit zu verhelfen, gerade im Bereich geistiger Behinderungen“, so Kristin Schetat. Teilnehmende aus anderen Projektgruppen hätten sich sogar wieder für die besondere Wohnform entschieden, weil sie zu viel Angst vor der Veränderung hatten. „Für diese Begleitung müssen wir uns Zeit nehmen können. Außerdem müssen wir unsere Mitarbeitenden schulen und entwickeln, auch für sie bedeutet die Umstellung auf Personenzentrierung mehr als eine fachliche Weiterentwicklung, es geht auch um eine neue Haltung und da müssen wir sie unterstützen.“ Dieser Mehraufwand bei der Einführung wird laut Schetat von den örtlichen Leistungsträgern noch nicht anerkannt und so konnte bisher noch keine Leistung nach dem neuen Prinzip verhandelt werden. Stattdessen werde weiterhin im Rahmen eines Festlegungsprotokolls die Leistung vergütet, doch die Umstellung auf die personenzentrierte Komplexleistung wird in Thüringen kommen. Was die Verhandlungen in Thüringen darüber hinaus erschwerten, sei das Hilfeplanverfahren, das – anders als in vielen anderen Ländern – noch nicht vom örtlichen Leistungsträger durchgeführt wird. Auch hier entstünden Mehraufwände beim Leistungserbringer, die nicht vergütet würden, die aber notwendig seien, um überhaupt eine Arbeitsgrundlage zu haben. Aber Kristin Schetat ist zuversichtlich: „Es ist ja in unser aller Sinne, dass wir hier weiterkommen und im Diskurs mit den Leistungsträgern werden wir sicher zu einem Ergebnis kommen, das alle Seiten zufriedenstellt.“
Für Kristin Schetat überwiegen ohnehin die Gewinne, die dieses Projekt für alle Beteiligten – die Wohlfahrtshilfe und vor allem die Kunden und Kundinnen – hatte. „Mit zehn beteiligten Menschen waren wir die kleinste Projektgruppe, aber es war großartig zu sehen, wie diese zehn über sich hinausgewachsen sind. Nicht nur haben sie gelernt, dass sie mit ihren Sorgen nicht allein dastehen und diese zu artikulieren, sie haben bei den Fachtagen gemeinsame Fortschritte vorgestellt und damit eine Rolle eingenommen, die sie bis dahin nicht kannten. Die Beteiligung der Menschen war selbst schon eine empowernde Teilhabeerfahrung“, so Schetat. Die Wohlfahrtspflege des Bundeslandes habe ebenfalls auf mehreren Ebenen profitiert. Wichtig sei insbesondere, dass sich die Träger besser vernetzt hätten, voneinander lernen konnten und so auch wissen, was in der großen Landschaft der Eingliederungshilfe passiert. „Es hat uns aber auch noch mal sehr schön vor Augen geführt, dass wir uns als freie Wohlfahrtspflege auch nicht vor weitreichenden Veränderungen scheuen dürfen. Die alten Strukturen der Fürsorge sind tief in uns verankert. Wenn wir unser Projekt vorgestellt haben, war die Reaktion häufig: ‚So machen wir das doch ohnehin schon‘, aber das ist nicht wahr. Die Leistungserbringung war sicherlich vorher auch schon gut und in Detailfragen auch kundenorientiert. Aber wir reden hier von einem strukturellen und kulturellen Paradigmenwechsel was die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen betrifft – und da müssen wir auch offen und ehrlich mit uns selbst ins Gericht gehen“, so Kristin Schetat. „Wir haben gelernt, dass wir nur gemeinsam funktionieren und dass wir fähig sind, großangelegte Kampagnen zu fahren, wenn nötig. Wir müssen den Change durch das BTHG nutzen, um auf uns, die Wohlfahrt, und auf die Teilhabe von Menschen mit Behinderung aufmerksam zu machen“, fordert sie. Mit Blick auf die Pandemie sei wieder einmal deutlich geworden, wie klein sich die Wohlfahrtspflege selbst halte. „Andere Branchen wie der Tourismus oder sogar das Friseur-Handwerk sind in der Krise stärker im öffentlichen Bewusstsein als wir – das kann nicht sein. In Thüringen haben wir uns auf den Weg gemacht, uns gemeinsam mehr Gehör zu verschaffen.“
Und das ist auch etwas, was Kristin Schetat mit Blick auf die BTHG-Umsetzung an sich fordert. „Die Lobby für unsere Arbeit bzw. die Menschen, für die wir sie erbringen, ist ohnehin nicht die größte und wir arbeiten vor allem mit Menschen mit geistigen und komplexen Beeinträchtigungen, da ist sie noch mal geringer“, so Schetat. So sind ihre Hoffnungen für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im gesamtgesellschaftlichen Kontext eher gering: „Sicherlich werden wir in den nächsten Jahren eine neue Leistungsform generieren können und es wird sich auch ein Haltungswandel vollziehen, aber der wird sich zuvorderst in der Profession der Eingliederungshilfe abzeichnen. Das ist schon ein enorm wichtiger Schritt, aber bis dieser sich in der gesamten Gesellschaft zeigt, ist es noch ein weiter Weg“, sagt Schetat auch mit Blick auf den Umgang mit Menschen mit Behinderung in der Pandemie. „Das BTHG steckt einen Rahmen, dieser muss jetzt mit Leben gefüllt werden. Die komplette Bandbreite der Gesellschaft muss Teilhabe mitdenken.“ Mit Blick in die Zukunft wünscht Kristin Schetat sich außerdem eine schärfere Ausgestaltung der Schnittstellen des SGB IX zu anderen Sozialgesetzbüchern, beispielsweise zur Pflegeversicherung. „Unser Ziel muss es sein, einen Sozialraum zu schaffen, der offen für alle Bedarfe der Menschen mit Behinderungen ist und Kooperationen außerhalb auch der Eingliederungshilfe ermöglicht.“
Eine pauschale Anleitung für die Ambulantisierung stationärer Angebote möchte Kristin Schetat nicht geben, verweist aber auf die Arbeitshilfe, die aus dem Projekt entstanden ist und viele hilfreiche Tipps bereithält. „Man hat in dem Projekt gesehen, dass die jeweiligen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen einzelner Einrichtungen so verschieden sind wie die Menschen, um deren Wohnbedingungen es geht“, so Schetat. Es müsse eine Vielzahl von Abläufen und Strukturen angepasst oder gar neu geschaffen werden, wenn der Wechsel von stationär zu ambulant gelingen soll. Es ginge um mehr als die Umwandlung von Mietverträgen oder bauliche Veränderungen. Im Kern ist die Ambulantisierung stationärer Angebote eine Personal- und Organisationsentwicklung, genau wie die gesamte Umsetzung des BTHG.
Die Arbeitshilfe finden Sie hier zum Download.
Text: Marie Kramp

Sie benötigen Unterstützung bei der Umsetzung des BTHG oder bei der Ambulantisierung Ihrer Angebote? Sprechen Sie uns unverbindlich an, gemeinsam finden wir eine Lösung!
contec - Gesellschaft für
Organisationsentwicklung mbH
Innovationszentrum Gesundheitswirtschaft
Gesundheitscampus-Süd 29
44801 Bochum
contec GmbH
Reinhardtstraße 31
10117 Berlin
contec GmbH
Sachsenstraße 20
20097 Hamburg
contec GmbH
Brienner Str. 45 a-d
80333 München
contec GmbH
Lautenschlagerstr. 23
70173 Stuttgart
contec - Gesellschaft für
Organisationsentwicklung mbH
Innovationszentrum Gesundheitswirtschaft
Gesundheitscampus-Süd 29
44801 Bochum
contec GmbH
Reinhardtstraße 31
10117 Berlin
contec GmbH
Sachsenstraße 20
20097 Hamburg
contec GmbH
Brienner Str. 45 a-d
80333 München
contec GmbH
Lautenschlagerstr. 23
70173 Stuttgart